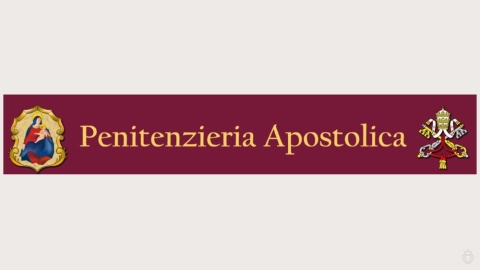Ein Zeugnis von Bischof Huonder: Die große Wunde (2) (Text)

Der Text des Zeugnisses von Bischof Vitus Huonder auf dem Youtube-Kanal Certamen wird nun in drei Teilen, entsprechend den drei Episoden des Videos, veröffentlicht.
Hier ist der Text der zweiten Episode (Transkript von Video Nr. 2):
5. Novus Ordo Missae
Die Priesterbruderschaft wäre in gewissem Sinne ein Kind der Krise der Kirche. Das haben wir festgestellt. Die Abkehr von der Tradition ist am schmerzhaftesten in der Änderung des Ritus des heiligen Messopfers zu spüren. War diese Änderung legitim? War dies die Absicht des Konzils? In der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium heißt es über die Heilige Messe: „Unser Erlöser hat das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes beim letzten Abendmahl, in der Nacht, in der er verraten wurde, eingesetzt, um das Kreuzesopfer in der Zeit bis zu seiner Wiederkunft zu verewigen und so der Kirche, seiner geliebten Braut, ein Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung anvertrauen zu können: als Sakrament der Güte, als Zeichen der Einheit, als Band der Liebe, als österliches Bankett, in dem Christus genossen wird, der Geist mit Gnade erfüllt wird und uns ein Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben wird“ (47). Andererseits warnt die Konstitution vor Neuerungen: „Schließlich sollen Neuerungen nur dann eingeführt werden, wenn der tatsächliche und sichere Nutzen für die Kirche es erfordert und wenn dafür gesorgt wurde, dass die neuen Formen gewissermaßen organisch wachsen“ (23). Trotzdem wurde uns ein neuer, stark veränderter Ritus mit einer ebenso stark veränderten Theologie der Messe vorgelegt.
Wie bereits erwähnt, wurde die Abkehr vom traditionellen eucharistischen Glauben 1969 mit der Apostolischen Konstitution Missale Romanum ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum und mit der Einführung des Novus Ordo Missae offensichtlich. Bei der Überprüfung des neuen Messordinarius im selben Jahr kam eine Expertenkommission zu folgendem Schluss: „Es ist offensichtlich, dass der Novus Ordo nicht mehr den Glauben von Trient repräsentieren will. An diesen Glauben ist aber das katholische Gewissen für immer gebunden. Der wahre Katholik sieht sich daher durch die Promulgation des Novus Ordo in einem tragischen Dilemma gefangen.“ Die Kommission wurde nicht wirklich ernst genommen. Eine Korrektur des Textes der Einleitung im Messbuch sollte diese Schwierigkeit lösen. Doch in Wirklichkeit blieb der Ordo selbst so konzipiert, wie er war, d.h. er stellte den Glauben von Trient nicht mehr vollständig dar. Dies wird lange Zeit später in dem Apostolischen Schreiben Desiderio Desideravi von 2022 deutlich werden. Man muss schon wegschauen, um nicht – trotz einiger katholisch anmutender Begriffe, Frömmigkeitshaltungen und Auslegungen der Feier – eine im Wesentlichen protestantische Auffassung der Heiligen Messe festzustellen. Der Brief bezieht sich auf das Konzil. Es versteht sich also als Auslegung der Konstitution des Konzils. Der Vergleich ist jedoch nicht stichhaltig.
6. Die authentische römische Liturgie
Die Liturgie der Kirche, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil überliefert wurde, ist im Wesentlichen die authentische römische Liturgie. Das ist eine historische Tatsache. Man kann sie nicht leugnen, man kann sie nur ignorieren.
Diese traditionelle Liturgie wird manchmal als „tridentinische Messe“ bezeichnet, was nicht ganz korrekt ist. Papst Pius V. führt keinen neuen „tridentinischen“ Ritus ein. Er übergibt der Kirche den traditionellen Text des heiligen Messopfers in gereinigter Form. In der Bulle Quo primum vom 14. Juli 1570 legte er in Bezug auf die Feier der heiligen Messe unter anderem fest: „Niemand ... kann gezwungen werden, die Messe anders zu feiern, als wir es festgelegt haben. Niemand darf gezwungen werden, dieses Messbuch zu ändern. Dieses Schreiben darf niemals widerrufen oder geändert werden. Es bleibt für immer in seinem gesamten Umfang in Kraft.“ Ein späterer Papst kann sich nicht über eine solche Bestimmung hinwegsetzen. Es ist ihm sowohl aufgrund des Alters des liturgischen Textes als auch aufgrund seines eigentlichen Zwecks unmöglich, dies zu tun. Denn diese Anweisung betrifft nicht einfach eine veränderbare Disziplin, sondern ein Glaubensgut, eine Glaubenswahrheit in Form eines Gebets, wie wir sagen würden. Die traditionelle römische Liturgie ist mit einem Glaubensbekenntnis vergleichbar. Sie kann in ihrer Substanz nicht verändert werden. Folglich kann sie auch nicht verboten werden. Mit seiner Bulle schafft Pius V. nicht etwas Neues. Er bekräftigt vielmehr die Legitimität der Glaubenspraxis in dieser Form der Liturgie. Er bestätigt die Echtheit dieses Glaubensbekenntnisses. Ein solches Gut kann den Gläubigen niemals genommen werden. Was im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil mit der absichtlichen Abschaffung des traditionellen Messritus geschah, ist eine Ungerechtigkeit, ein Machtmissbrauch.
7. Mittel der Druckausübung
Zwei Begriffe waren für die Entwicklung des Lebens der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil – und damit auch für die Krise – entscheidend: Gehorsam und das lebendige Lehramt. Man kann sie in einem Satz zusammenfassen: Absoluter Gehorsam ist dem lebendigen Lehramt geschuldet.
Ein falsches Verständnis dieser beiden Begriffe hat in den letzten Jahren zu einer Entgleisung im Leben der Kirche geführt. Tatsächlich wurden diese beiden Begriffe als Druckmittel für die Akzeptanz von Neuerungen eingesetzt. In der Vergangenheit wurden die Gläubigen nicht ausreichend mit der Tragweite des Gehorsams vertraut gemacht. Sie wurden nicht ausreichend über die Bedeutung des Lehramts und der Tradition unterrichtet. Allzu oft wurde Gehorsam auf unterwürfige und sklavische Weise verstanden, als Kadavergehorsam.
Angriffe auf die Kirche und ein zu enges Verständnis der päpstlichen Autorität, vor allem seit dem 18. und 19. Jahrhundert, führten dazu, dass man nur noch absoluten, widerspruchsfreien Gehorsam kannte. Dieser Gehorsam wurde den Gläubigen eingetrichtert. So fügten sie sich widerspruchslos dem, was als angeblich notwendige Erneuerung der Kirche dargestellt wurde. Angesichts dessen betonte Erzbischof Lefebvre bei einer Audienz mit Papst Paul VI. am 1. September 1976: „Ich würde gerne auf die Knie gehen und alles akzeptieren, aber ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln.“
Diese Haltung wäre damals für viele Gläubige undenkbar gewesen. Man traute sich nicht, dies gegenüber der kirchlichen Autorität zu tun. Die Berufung auf das Gewissen wurde nur unzureichend erklärt. Der Verlauf dieser Anhörung ist übrigens sehr aufschlussreich für die Art und Weise, wie man damals mit Autorität umging und zum Teil auch heute noch umgeht! Der Missbrauch von Autorität (Terrorisierung der Gläubigen) ist immer möglich. Jeder Katholik muss sich dessen sehr bewusst sein.
Der andere Begriff, der des lebendigen Lehramts, wurde und wird oft missbraucht, um neue Lehren zu präsentieren, die nicht in der Tradition verankert sind. Die päpstliche Autorität ist jedoch, wie jede kirchliche Autorität, an die Regel des Glaubens gebunden. In diesem Sinne legt die kirchliche Autorität nicht fest, was geglaubt werden soll. Sie übernimmt das Glaubensgut, bewahrt es auf, verteidigt es und gibt es weiter. Dies ist mit dem Begriff „lebendiges Lehramt“ gemeint. Das Lehramt kann keine willkürliche Änderung des Glaubens vornehmen und zur Annahme desselben zwingen.
Hier, in der Regel des Glaubens, wie er überliefert wurde, finden wir das Kriterium, um die Haltung und das Handeln von Erzbischof Lefebvre richtig zu beurteilen. Er tat nichts anderes als das, was die Pflicht eines Bischofs und sogar aller Gläubigen ist: die Lehren und Handlungen der kirchlichen Autorität im Licht der Glaubensregel zu prüfen.
8. Fehlen der Pietas
Der Codex Iuris Canonici (CIC) ist kein dogmatisches oder moralisches Lehrbuch. Er ist jedoch ein Schutz für die Glaubenslehre, für das Leben aus dem Glauben. Er ist in erster Linie für das Heil der Gläubigen bestimmt.
Nun lesen wir bereits im Codex von 1917, in der zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils gültigen Sammlung des Kirchenrechts, in Can. 23: „Im Zweifelsfall wird der Widerruf eines Gesetzes nicht vermutet, sondern die späteren Gesetze müssen mit den früheren Gesetzen in Verbindung gebracht und, wenn möglich, mit ihnen in Einklang gebracht werden.“ Dieses Prinzip wurde auch in den Codex des kanonischen Rechts von 1983 in Can. 21 aufgenommen. Wenn ein solches Prinzip für die menschliche Rechtsprechung, das positive kirchliche Recht gilt, muss es umso mehr für die Lehrverkündigung und die Regelung des liturgischen Lebens – für den Schutz des göttlichen Rechts – gelten. Denn das Heil der Gläubigen steht unmittelbar auf dem Spiel.
Von diesem Grundsatz her müssen alle Neuerungen und Veränderungen in der Kirche seit dem Konzil beurteilt werden. Inwieweit besteht eine Übereinstimmung mit der Lehre der Vergangenheit? Auch in dieser Hinsicht gibt es eine Pietas, eine Ergebenheit und eine Wertschätzung, einen Respekt vor den Vätern, vor der Vergangenheit der Kirche, vor der traditionellen Lehre und Moral. Was den Glauben betrifft, gibt es keine Wahl. Was später ist, muss mit dem übereinstimmen, was früher war. Das Glaubensbekenntnis muss mit dem Evangelium und den anderen offenbarten Texten übereinstimmen. Die Konzilsbeschlüsse müssen mit dem Glaubensbekenntnis übereinstimmen. Spätere Konzilsbeschlüsse müssen mit den früheren verbindlichen Konzilsbeschlüssen übereinstimmen. Genau diese Pietas hat in der konziliaren und postkonziliaren Zeit gefehlt. Wie wurde damals mit dem Erbe der Kirche, den Kirchen und ihrem Mobiliar, den heiligen Gewändern, den an die Tradition gebundenen Menschen und den Priestern, die aus Gewissensgründen der überlieferten Liturgie treu bleiben wollten, umgegangen? Dies belastet die Kirche noch heute! Wie arrogant die Theologen mit ihren Lehren und in ihrer Illusion, zu den Ursprüngen der Kirche zurückzukehren, geworden sind! Der Slogan lautete: „Mit der Kirche wird jetzt alles besser. Wir sind die Generation, die eine positive Wende bringt.“ Das war so ziemlich die Geisteshaltung, die in weiten Kreisen herrschte, eine Geisteshaltung, die dazu führte, dass man auf die Vergangenheit herabblickte, mit Verachtung, Sarkasmus und Selbstgefälligkeit, und die nicht davor zurückschreckte, selbst das zu verachten, was heilig und unantastbar war.
Seit dem Pontifikat von Paul VI. stellen wir immer wieder schwere Verstöße gegen die Lehre und Disziplin der Kirche fest, bei denen die Pietas missachtet wird. Am schlimmsten war zweifellos der Angriff auf die Liturgie der Messe. Über das Heiligste unseres Glaubens wurde ohne Pietas, ohne Respekt, verfügt. Dennoch hat die Kirche die heiligen Texte und die liturgischen Anweisungen stets mit größter Sorgfalt bewahrt und weitergegeben. Änderungen oder Bereicherungen hat sie nur mit großer Zurückhaltung und Respekt vorgenommen. In Bezug auf das heilige Messopfer gilt besonders der Grundsatz, den das Erste Vatikanische Konzil in Bezug auf die Befugnisse des Papstes formuliert hat, der aber an sich für jedes kirchliche Amt gilt: „Der Heilige Geist wurde den Nachfolgern des heiligen Petrus nicht verheißen ..., damit sie unter seiner Offenbarung eine neue Lehre bekannt machen, sondern damit sie mit seinem Beistand ... das Glaubensgut heilig bewahren und treu darlegen“ (DS 3070). Man kann sich nach all dem, was geschehen ist, fragen: War das, was getan wurde, ein glaubwürdiger Schritt? War es von der Pietas diktiert?
(Quelle: Certamen/FSSPX.Actualités – FSSPX.Actualités)